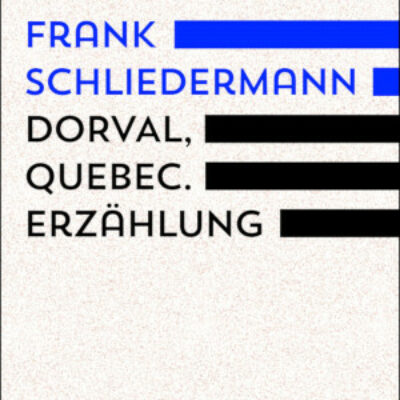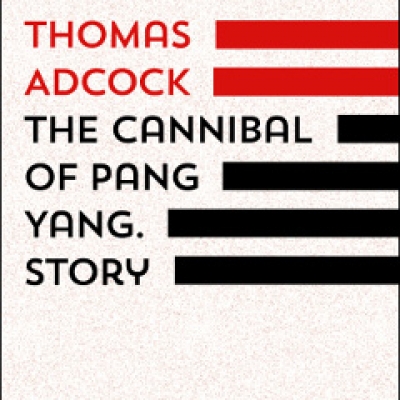Erhältlich u.a. bei
CulturBooks Minimore MyBookShop Amazon beam Hugendubel eBook.de Osiander Ocelot
beam Hugendubel eBook.de Osiander Ocelot
Über das Buch
Raimundo und Raimunda leben im Paradies: in einem Paranussbaumwald an einem Fluss mitten im Nirgendwo Brasiliens, die nächsten Nachbarn sind Dutzende Kilometer entfernt. In einer alten Truhe hüten sie ein kostbares Erbstück: einen Fußball, den einst ihr Großvater in den Urwald brachte.
Als eines Tages ein Händler mit einem Radio bei den Geschwistern auftaucht, ändert sich ihre Welt für immer. Rund um die Uhr lauscht Raimundo nun den Stimmen aus einer anderen Welt, besonders besessen ist er von den Fußballübertragungen mit ihrer Dramatik und Spannung. Unvorsichtig geworden, lässt er sich mit dem Händler auf einen zweifelhaften Deal ein, um mehr über dieses faszinierende Spiel zu lernen. Doch der Besuch aus der Zivilisation hat es auf etwas ganz anderes abgesehen …
Eliane Brum erzählt in einer wunderschönen Sprache und mit gnadenloser Konsequenz von Unschuld und Schuld, von der Magie des Balls und der Vertreibung aus dem Paradies. Ein virtuoser Chôro (»brasilianischer Blues«) und ein bitterböser Kommentar zur Fußball-WM in Brasilien.
Diese Geschichte ist eine Single-Auskopplung aus dem Buch »Der schwarze Sohn Gottes – 16 Fußballgeschichten aus Brasilien«, das im Verlag Assoziation A erschienen ist und auf verschiedene Art und Weise von der Magie des Fußballs berichtet.
Über die Autorin
Eliane Brum (geb. 1966 in Ijuí, Rio Grande do Sul) ist Schriftstellerin, Journalistin und Dokumentarfilmerin. Sie schrieb die Reportagebände »Coluna Prestes: O Avesso da Lenda« (1994), »A vida que ninguém vê« (2006) sowie »O olho da rua: Uma repórter em busca da literatura da vida real« (2008). 2001 erschien ihr erster Roman »Uma Duas«. Mit Débora Diniz drehte sie 2005 den Dokumentarfilm »Uma vida severina« und 2010 mit Paschoal Samora »Gretchen filme estrada«. Sie lebt in São Paulo und ist Fan von Grêmio.
Über den Übersetzer
Michael Kegler (* 1967 in Gießen) übersetzt seit 1992 aus dem Portugiesischen. Seit 2001 betreibt er das Internetportal nova cultura, das über Literatur und Musik aus den Ländern des portugiesischen Sprachraumes informiert und ist Mitglied im Vorstand der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. Er lebt in Hofheim am Taunus. 2014 wird Kegler gemeinsam mit Marianne Gareis für seine Übersetzungen aus dem brasilianischen Portugiesisch mit dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW ausgezeichnet.
Leseprobe
Raimundo erinnert sich noch, wie er seinen Vater einmal gefragt hat, ob denn die ganze Welt grün sei. Der Vater war ein sehr kleiner Mann, und als er den Jungen anschaute, leuchteten seine Augen in der Farbe der Augen einer Waldkatze. Grün. Mein Vater hat es von seinem Vater und der hat es von seinem Vater erfahren, dass die Welt draußen nicht grün ist. Sie waren auf bloßen Füßen durch den Wald unterwegs zu den Paranussbäumen gewesen, die schon dem Vater des Vaters des Vaters gehört hatten. Vater, fragte Raimundo noch einmal, kennst du die Welt draußen? Nein. Nur der Vater des Vaters des Vaters hatte sie noch gekannt. Es ist besser, wir kennen sie nicht. Warum? hatte der Junge gefragt. Weil es besser ist, dass die Welt draußen von uns nichts weiß. Und warum? Weil dies hier für uns der letzte Ort ist. Wenn sie uns entdecken, ist es zu Ende. Warum? Es ist besser für manche, vergessen zu werden. Sie kamen zu den Paranussbäumen, und Raimundo konnte sehen, wie der Blick seines Vaters sich aufhellte. Einmal hatte er den Jungen mit seinen klauenartigen Händen gepackt, so kräftig, dass es wehgetan hatte. Raimundo, ein Mann ist sein Paranussbaum. Daran sollst du immer denken. Raimundo hatte es mit einem Nicken versprochen. Doch er riskierte ein letztes Warum. Vater, ist das hier das Ende der Welt? Nein, Raimundo. Es ist die Mitte.
Raimundo erinnerte sich an diese Szene, als er nun am Ufer des Iriri saß. Der Vater war tot. Erst als er ihn auf seinen Armen trug, war ihm aufgefallen, dass der Vater ein sehr kleiner Mann gewesen war. Der Vater war keine Waldkatze gewesen, sondern ein Vogel, vielleicht hatte er Angst gehabt. Doch Raimundo war nicht wie der Vater, er trug nur seinen Namen. Er war nicht nur groß und kantig, sondern er sehnte sich auch nach der Welt, seit er sich mit Menschen verständigen konnte. Es war wie ein Loch, das in ihm immer größer wurde und ihm zeigte, dass er innen viel größer war als außen. Innen spürte Raimundo, dass er kein Ende hatte. Und das machte ihm solche Angst, dass er mit den Zähnen klapperte.
An jenem Tag, an dem er seinem Vater versprochen hatte, sich sein Leben lang um die Paranussbäume zu kümmern und dem das Leben eines Sohnes und das des Sohnes des Sohnes zu opfern, hatte der Vater seine Hand so sehr gedrückt, dass er sie ihm entziehen wollte. Doch er tat es nicht, weil es nicht erlaubt war. Schließlich ließ der Vater wieder locker. Nun kann ich dir die Welt geben, denn ich weiß, dass du hierbleibst. Und der kleine Raimundo hatte es in seinem Kopf sausen gespürt, als wüchsen ihm Flügel, die Flüsse überwinden, weil der Vater ihm die Welt geben würde, doch gleichzeitig sah er seine Füße sich strecken, seine Zehen immer länger werden und sich in Wurzeln aus Fleisch verwandeln, die sich für immer in den Leib des Paranusshains krallen würden. Und seitdem wuchs er gespalten heran, halb ein Vogel und halb ein Baum.
Der Vater hatte ihn, der noch ganz benommen war von diesem neuen Körpergefühl, von dort fortgeführt und Mutter und Schwester hinausgeschickt, als sie das Haus aus Lehmwänden betraten, die alle Raimundos vor ihnen mit eigenen Händen errichtet und ausgebaut hatten. In einer Ecke des einzigen Raums stand die verbotene Truhe. Sie war so groß wie ein Tapir, aus altem Leder, und hatte dem Urgroßvater gehört, dem ersten, der einen Fuß in das Innere des Inneren gesetzt hatte, noch ohne zu wissen, dass er von dort nie mehr herauskommen würde.
Niemand, nicht einmal die Mutter, durfte die Truhe öffnen. Wenn es im Vater brodelte, in menschlichen Unwettern, öffnete er sie selbst, feierlich und strich über vergilbte Papiere, als ließe ein Wunder ihn plötzlich entziffern, was dort geschrieben stand. Doch der Vater war blind für die Buchstaben, wie sie es alle waren, nach dem Urgroßvater, denn die Schule hatte als Erste geschlossen, als Gummi fast nur noch so wenig wert war wie ein Mensch. Wenn er dann wieder und wieder feststellte, dass die Schrift ihm entglitt, ohne sich zu erkennen zu geben, schloss der Vater die Truhe mit einer Wut, die größer war als er selbst, und stürzte zur Tür hinaus. Ließ sich vom Dschungel verschlingen. Und dann wussten sie, dass er erst wieder am nächsten Morgen ausgespien würde, die Arme und Beine von Blut verschmiert, doch die Katzenaugen schon wieder besänftigt.
Als der Vater die Truhe an dem Tag, an dem Raimundos Kindheit zu Ende war, öffnete, dachte der Junge, die Welt sei vielleicht in den vergilbten Papieren. Und fürchtete, sie bliebe für ihn womöglich für immer verschlossen, entfernt, nicht erreichbar zu Fuß und noch nicht einmal mit dem Boot. Nicht einmal auf Flügeln. Doch der Vater hatte seine Arme noch tiefer hineingetaucht und mit einer Vorsicht, die kaum zu ihm passen wollte, ein in rotes, gesticktes Tuch, das so schön war, dass es nur von draußen sein konnte, umwickeltes Etwas herausgefischt. Und so ernsthaft, dass es Raimundo den Atem nahm, ließ der Vater daraus etwas Rundes zum Vorschein kommen aus braunem Leder, das vielleicht irgendwann einmal weiß, doch wie alles hier, das nicht grün war, nun auch zu Erde geworden war.
Raimundo, mein Sohn, das hier ist die Welt. Raimundo schaute das Ding an und dachte, es könne unmöglich die Welt sein, und fragte, Was ist das, Vater? Und Angst klang wie eine Schneide aus seinen Worten. Das ist ein Fußball.